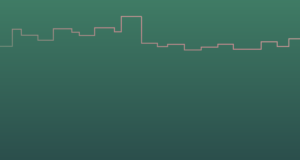Greenwashing: Die Masche mit dem Ökostrom
Nachhaltigkeit und Klimaschutz gehören zu den wichtigsten Aufgaben in der heutigen Zeit. Gleichzeitig bringen sie jedoch auch große finanzielle und organisatorische Herausforderungen für Unternehmen und Privatpersonen mit sich. Nachhaltigkeit wird noch immer als zusätzliche Bürde angesehen – zur Regel geworden ist nachhaltiges Handeln noch lange nicht. Vielmehr entstehen immer wieder Situationen, in denen Unternehmen sich für den Klimaschutz positionieren, aber in Wirklichkeit gar nicht nachhaltig handeln. Greenwashing ist in den letzten Jahren zum Problem geworden – immer wieder werden Verbraucher in den unterschiedlichsten Lebenssituationen getäuscht. Aber was bedeutet Greenwashing genau? Wir erklären das Thema und zeigen, wie es in Zusammenhang mit Ökostrom steht.
Was ist Greenwashing? Eine Definition
Für Greenwashing gibt es eine offizielle Definition im Wörterbuch: Es handelt sich um einen „Versuch (von Firmen oder Institutionen), sich durch Geldspenden für ökologische Projekte, PR-Maßnahmen o.Ä. als besonders umweltbewusst und umweltfreundlich darzustellen“. Was in der Definition recht eindeutig klingt, ist in der Realität oft nicht so einfach zu erkennen. Schließlich ruft kein Unternehmen in die Welt hinaus, dass ihre grüne Imagekampagne gleichzeitig umweltschädliches Verhalten an anderer Stelle verdecken soll. Wie kann man nun also Greenwashing erkennen? Es gibt einige Anhaltspunkte, an denen man sich orientieren kann:
- Zertifizierungen: Wirbt ein Unternehmen mit nachhaltigen Produkten, kann es diese in der Regel offiziell zertifizieren lassen – im Lebensmittelbereich zum Beispiel durch Demeter oder in der Kleidungsbranche durch IVN Best. Der TÜV und andere Anbieter bieten beispielsweise unabhängige Ökostromzertifizierungen oder Herkunftsnachweise für Stromanbieter an. Offizielle und unabhängige Siegel lassen sich in der Regel durch minimalen Rechercheaufwand finden und überprüfen. Wirbt ein etabliertes Unternehmen ohne Zertifizierung mit Nachhaltigkeit, solltest Du hellhörig werden.
- Gesetzliche Anforderungen: Eine wichtige Frage in Bezug auf Greenwashing ist folgende: Erfüllt das Unternehmen lediglich die gesetzlichen Anforderungen und wirbt damit oder handelt es sich bei der Werbebotschaft tatsächlich um einen zusätzlichen Schritt in Richtung Nachhaltigkeit? Die Erfüllung gesetzlicher Standards sollte nicht alleinstehend als Werbemaßnahme verwendet werden und kann auf Greenwashing hindeuten. Denn diese Standards hat jedes Unternehmen zu erfüllen.
Wie lassen sich Nachhaltigkeit und Greenwashing miteinander vereinbaren?
Greenwashing ist nicht immer Absicht. Immer wieder kommt es vor, dass Unternehmen in eine „Nachhaltigkeitsfalle“ tappen, indem sie von ihren nachhaltigen Ansätzen berichten, aber nicht die weiteren Herausforderungen thematisieren. Für Verbraucher gilt es an dieser Stelle, bei Werbekampagnen genau hinzusehen: Transparenz ist hier das wichtige Stichwort. Wir können von kaum einem Unternehmen erwarten, dass es zu 100 Prozent nachhaltig handelt, um damit werben zu dürfen. Gerade Start-ups haben oftmals direkt am Anfang noch nicht das nötige Budget, um alle entsprechenden Zertifizierungen zu beantragen.
Vielmehr geht es darum, dass offen über Ziele gesprochen und eine langfristige Strategie kommuniziert wird. Wirbt ein Stromerzeuger zum Beispiel damit, dass der von ihm produzierte Ökostromanteil um 40 Prozent gestiegen ist, sollten wir die Augen nach einem Hinweis offenhalten, wie dies erreicht wurde. Ebenfalls erhöht die Thematisierung weiterer Ziele die Transparenz. So lässt sich gut herausfinden, ob es sich um Greenwashing oder eine transparente Marketingkampagne handelt.
Ökostrom-Zertifikate unter die Lupe genommen: Wie nachhaltig sind sie wirklich?
Besonders die Energiebranche fokussiert sich zunehmend auf Nachhaltigkeit – erneuerbare Energiequellen müssen ausgebaut werden, damit wir uns klimaneutral mit Energien versorgen können. Viele Stromanbieter verkaufen inzwischen Ökostrom – auch in interessanten, flexiblen Tarifen. Der Begriff an sich ist jedoch nicht geschützt, sodass „Öko“ nicht unbedingt wirklich nachhaltig sein muss. Das Risiko für Greenwashing ist demnach groß. Einen Ansatz zur Problemlösung sollen Ökostrom Zertifikate darstellen. Sie sollen bestätigen, dass im Ökostrom auch wirklich grüne Energie steckt. Wir stellen einige Zertifikate und ihre Bedingungen vor:

TÜV Nord
Für das Ökostrom Zerifikat „Geprüfter Ökostrom“ vom TÜV Nord muss der Anbieter Strom aus 100 Prozent erneuerbaren Energien verkaufen. Das zertifizierte Produkt darf nicht subventioniert werden, zum Beispiel durch Einspeisevergütungen. Auch der Bau von Neuanlagen muss gefördert werden – konkret müssen mindestens 33 Prozent des Stroms in neuen Anlagen produziert werden, ansonsten muss ein festgelegter Betrag in den Neubau investiert werden. Hier können jedoch noch klimaschädliche Kraft-Wärme-Kopplung_Anlagen zum Einsatz kommen.

TÜV Rheinland
Ähnlich sind die Kriterien des TÜV Rheinland. Auch hier muss der Strom zu 100 Prozent aus erneuerbaren Quellen kommen – CO₂-Neutralität muss auch bei der Lieferung und der Stromgewinnung garantiert werden, weshalb Kraft-Wärme-Kopplung-Anlagen nicht zur Stromerzeugung verwendet werden dürfen.

Hinter diesem Label steht das Freiburger Öko-Institut, gemeinsam mit der Verbraucherzentrale NRW. Neben Strom aus erneuerbaren Energien müssen Anbieter auch nachweisen, dass sie in keiner Weise an Atom- oder Braunkohlekraftwerken beteiligt sind – auch nicht als Konzerntochter. Außerdem liegt der Fokus stark auf dem Ausbau umweltfreundlicher Energieanlagen.

Bei diesem Label handelt es sich um das älteste Label für Ökostrom, beteiligt sind zum Beispiel der NABU und der BUND. Auch hier ist die Beteiligung an Atom- oder Kohlekraftwerken Ausschlusskriterium. Zudem müssen Unternehmen, die sich mit dem Label auszeichnen möchten, zusätzlich zur Versorgung mit Strom aus 100 Prozent erneuerbaren Energien eine nachhaltige Unternehmenspolitik betreiben.

Für dieses Zertifikat muss der Strom ebenfalls aus 100 Prozent erneuerbaren Energien stammen. Die Bezugsquellen müssen dabei eindeutig identifizierbar sein. Falls CO₂-Vorkettenemissionen (bspw. beim Bau von Anlagen für Erneuerbare Energien) entstehen, müssen diese der Höhe entsprechend ausgeglichen werden, indem in Klimaschutzprojekte investiert wird. Dieses Zertifikat erfüllt zudem vollumfänglich die Prüfkriterien des TÜV Rheinlands.
Die strengsten Kriterien gibt es beim Grüner Strom-Lable und beim ok-power-Lable. Alle Label bescheinigen jedoch, dass der Anbieter zu 100 Prozent Strom aus erneuerbaren Energien verkauft. Die weiteren Kriterien beschreiben vor allem die Unterstützung des Ausbaus der Anlagen.
Die Schwachstellen von Ökostrom-Zertifikaten
Es gibt jedoch ein grundlegendes Problem bei Ökostrom-Zertifikaten: Je nach Zertifikat werden noch immer fossile Energieanlagen direkt oder indirekt durch den Anbieter mit unterstützt. Oft ist zudem im Strompreis ein Förderbeitrag enthalten, der den Ausbau erneuerbarer Energien weiter beschleunigen soll – entsprechend teurer ist der Strom.
Hinzu kommt, dass wir in Deutschland einen Strommix beziehen. Egal, ob du von einem Ökostromanbieter oder einem regulären Anbieter Strom beziehst, aus der Steckdose kommt der gleiche Strom. Denn es gibt kein spezielles Stromnetz für Ökostrom. Jeder Energieerzeuger speist seinen Strom in das deutsche Stromnetz ein. Dabei variiert natürlich auch der Anteil an Ökostrom im Netz. Dieser ist besonders hoch, wenn es beispielsweise sehr windig ist oder die Sonne scheint, da zu solchen Zeiten Windkraft- und Photovoltaikanlagen besonders effektiv arbeiten können.
Daher können Zertifikate allein nicht die Lösung sein, um die Nachhaltigkeit eines Stromanbieters zu beurteilen. Es geht vielmehr um das Gesamtbild der Maßnahmen.
Alternative Option für Haus & E-Auto: Smartes Laden

Viele regenerative Energiequellen können die produzierte Menge an Strom nicht steuern. Photovoltaikanlagen produzieren beispielsweise besonders viel Energie, wenn die Sonne scheint. Umso mehr Energie in das Stromnetz eingespeist wird, desto günstiger ist der Strompreis zu dem Zeitpunkt, um eine Überlastung des Netzes zu verhindern.
Genau an diesem Punkt setzt Rabot Energy an. Neben unserem Ökostromzertifikat von KlimaInvest setzen wir auf einen untertägigen Energiekauf. Unser Algorithmus prüft alle 15 Minuten die Preise an der Strombörse und prognostiziert anhand vielfältiger Faktoren, ob der Strompreis steigt oder fällt. Damit wird auch entschieden, ob Strom eingekauft und das Elektroauto geladen wird oder auf einen besseren Zeitpunkt gewartet werden soll. Dadurch können wir Strom ankaufen, wenn der Ökostromanteil im Stromnetz besonders hoch ist.
In der Rabot App siehst du jederzeit, wie hoch der aktuelle Ökostromanteil im gesamten Stromnetz ist und kannst sogar aktiv entscheiden, ob du dein Auto in dieser Situation laden möchtest – hiermit hast du direkten Einfluss auf die Nachhaltigkeit deines Ladevorgangs.
Natürlich muss dein E-Auto auch zuverlässig genau dann geladen sein, wenn du es brauchst. Um dies sicherzustellen, kannst du unkompliziert in unserer App eine Uhrzeit festlegen, zu der das Auto fertig geladen sein soll.
Wir von Rabot Energy bieten einen intelligenten Ladetarif an, der alle 15 Minuten den Strompreis an der Strombörse überprüft und das E-Auto nur dann lädt, wenn der Preis besonders günstig ist.
Ist die THG-Quote Greenwashing?
Auch dem THG-Quotenhandel wird immer wieder Greenwashing vorgeworfen. Schließlich können Unternehmen, die einen zu hohen CO2-Ausstoß verursachen, sich so von möglichen Strafzahlungen freikaufen. Laut Kritikern verkaufen beispielsweise Fahrer von Elektroautos ihre saubere Fahrweise und unterstützen große Konzerne bei der Belastung der Umwelt. Beim Handel mit THG-Zertifikaten handelt es sich jedoch aus mehreren Gründen nicht um Greenwashing:
- Durch die THG-Quote soll kein grünes Image für ein Unternehmen oder den Staat aufgebaut werden
- Umweltbewusste Unternehmen wie zum Beispiel Ladepunktbetreiber werden finanziell unterstützt und können durch den Quotenhandel den Ausbau von Ladeinfrastruktur vorantreiben
- Der Umstieg auf E-Mobilität wird attraktiver
- Die Quote kann als Motivation für betroffene Unternehmen gesehen werden, auf erneuerbare Energien zu setzen
Geht es um Greenwashing, können die Grenzen zwischen Nachhaltigkeit und grünem Markenanstrich schnell verschwimmen. Für Unternehmen gilt es, vor allem Wert auf transparente Kommunikation und eine klare Strategie für mehr Nachhaltigkeit zu legen. Verbraucher hingegen sollten sich umfassend informieren, nicht alle Werbekampagnen sofort glauben, aber auch nicht hinter jeder Ecke vorsätzliches Greenwashing erwarten. Die komplexe Situation zeigt einmal mehr, dass gesetzliche Regelungen zum Thema Klimaschutz weiter ausgebaut werden müssen.
Fazit
Greenwashing entlarven: Verbraucher stärken, Unternehmen in die Pflicht nehmen
Greenwashing bleibt eine Herausforderung für Verbraucher auf der Suche nach wirklich nachhaltigen Produkten. Um dieser Täuschung zu begegnen, ist es von entscheidender Bedeutung, auf offizielle Zertifizierungen wie das Grüner Strom-Label oder das ok-power-Label zu achten und sich über die langfristigen Nachhaltigkeitsziele der Unternehmen zu informieren. Darüber hinaus bieten innovative Ansätze wie das smarte Laden von Rabot Energy Möglichkeiten, aktiv auf den eigenen ökologischen Fußabdruck Einfluss zu nehmen. Diese Diskussion unterstreicht die gemeinsame Verantwortung von Unternehmen und Verbrauchern: Unternehmen sollten auf transparente Kommunikation und ehrliche Maßnahmen setzen, während Verbraucher bewusste Kaufentscheidungen treffen und sich kontinuierlich über die tatsächliche Nachhaltigkeit informieren sollten. Eine verstärkte gesetzliche Regulierung und Sensibilisierung für das Thema Nachhaltigkeit sind unerlässlich, um den Schutz unseres Planeten langfristig zu gewährleisten.